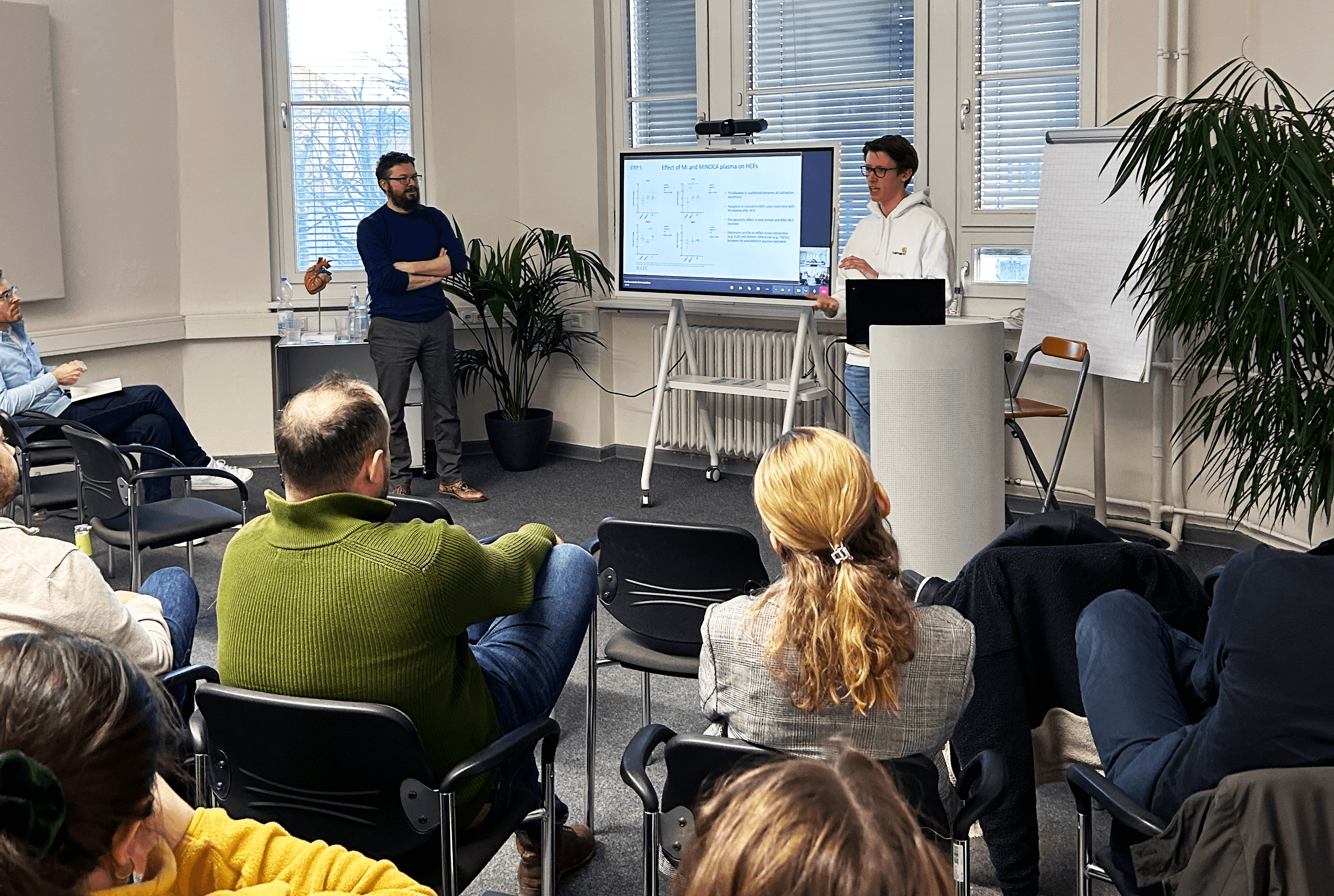Prof. Felix Schönrath (Klinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie) thematisierte die Herausforderungen und Fortschritte in der Behandlung der fortgeschrittenen Herzinsuffizienz und des kardiogenen Schocks. Er hob die hohe Mortalität dieser Erkrankungen hervor und gab einen Überblick über die Entwicklung der mechanischen Kreislaufunterstützung (MCS) am Deutschen Herzzentrum. Moderne Unterstützungssysteme (LVADs), wie magnetisch levitierte Pumpen, besitzen zwar eine verbesserte Hämokompatibilität und steigern die Überlebensrate auf 50 % nach 60 Monaten, jedoch bleiben die Umkehr des Krankheitsprozesses und das erfolgreiche Absetzen des LVAD seltene Ereignisse. Klinische Studien und Registerdaten zeigen nur begrenzte Erholungsraten, bedingt durch die dauerhafte neurohumorale Überstimulation unter leitliniengerechter medikamentöser Therapie. Der Vortrag betonte die Notwendigkeit personalisierter Behandlungsstrategien zur Verbesserung der Prognose bei Patienten mit fortgeschrittener Herzinsuffizienz.
Dr. Anna Feuerstein (Klinik für Kardiologie, Angiologie und Intensivmedizin, CVK) hob in ihrer Präsentation die Bedeutung des körperlichen Trainings bei Herzinsuffizienz hervor und unterstrich dessen nachgewiesene Vorteile für Lebensqualität, funktionelle Kapazität und Reduktion von Krankenhausaufenthalten. Die Wirksamkeit ist nicht nur bei HFrEF und HFpEF belegt, sondern auch bei Patienten mit LVADs, wobei Studien sowohl die Sicherheit als auch relevante Verbesserungen der Belastbarkeit und des vom Patienten eingeschätzten Wohlbefindens zeigen. Ein personalisiertes Programm, das Ausdauer- und Krafttraining kombiniert, zeigte die besten Ergebnisse. Neue Ansätze wie robotergestützte Mobilisierung (z. B. MyoSuit) werden derzeit erforscht, ebenso wie die zugrunde liegenden molekularen Mechanismen. Trotz klarer Leitlinienempfehlungen besteht weiterhin eine wesentliche Lücke beim breiten und wohnortnahen Zugang zu Herzinsuffizienz-Trainingsprogrammen.
Herzinsuffizienz mit erhaltener Ejektionsfraktion (HFpEF) weist häufig die Komplikation einer rechtsventrikulären (RV) Dysfunktion auf, die mit ungünstigen Verläufen einhergeht, deren Mechanismen jedoch bislang unzureichend geklärt sind. Die PhD-Studentin Lara Jaeschke (AG Grune, CCM) entwickelte ein neues HFpEF-Mausmodell mit sekundärer pulmonaler Hypertonie und rechtsventrikulärer Maladaption, um die Rolle der unspezifischen Immunzellen in der Krankheitsentstehung zu untersuchen. Mithilfe des Mausmodells und von Patientenbiopsien konnte sie zeigen, dass die Rekrutierung/Akkumulierung von Makrophagen und die Expansion von Neutrophilen die Freisetzung profibrotischer und proinflammatorischer Mediatoren antreiben, was zu Fibrose, RV-Hypertrophie und Dysfunktion führt. Die gezielte Reduktion der Makrophagen verbesserte die RV-Funktion nachweislich und normalisierte die inflammatorische sowie fibrotische Genexpression. Damit wurden myeloide Zellen als kausale Treiber der RV-Pathologie bei HFpEF identifiziert und als potenzielle therapeutische Zielstrukturen identifiziert.
*Deutscher Herzbericht 2024